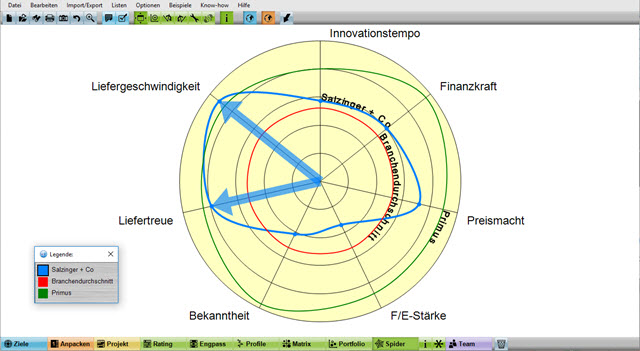Ein "gesundes Feindbild"?
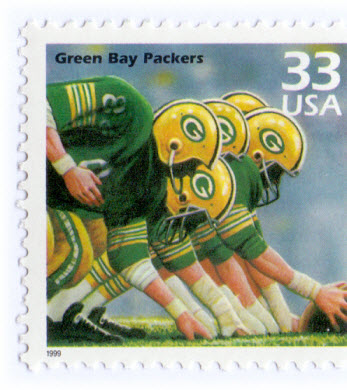 Erfolgsfaktoren
haben viele Gesichter: Ein "gesundes Feindbild", so hat man herausgefunden,
zählt zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren eines Unternehmens.
Mannschafts-Sportarten kommen zur Motivation kaum
ohne sorgfältig gepflegte Feindbilder aus.
Erfolgsfaktoren
haben viele Gesichter: Ein "gesundes Feindbild", so hat man herausgefunden,
zählt zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren eines Unternehmens.
Mannschafts-Sportarten kommen zur Motivation kaum
ohne sorgfältig gepflegte Feindbilder aus.
Gesund ist daran, wenn man von den Stärken der
Wettbewerber lernt. Und da kommt auch schon Benchmarking
ins Spiel: Richtig vergleichen, Nachteile ausgleichen,
Vorteile ausbauen.
Benchmarking (Amazon Affiliate Link)
ist mehr als ein Modethema. Es liefert eine ausgezeichnete
Grundlage für Engpass-Analysen.
Wer sich mit anderen Unternehmen oder Personen
vergleicht, findet heraus, wo Stärken und Schwächen
liegen. Wenn jemand etwas mit deutlich weniger Aufwand
oder mit deutlich besserem Ergebnis kann, dann ist
das ein guter Punkt zum Nachdenken, Hinzulernen
und Verbessern.
Beispiel Webseiten-Vergleich
Wie ist Ihre Webseite im Vergleich zu Wettbewerbern
aufgestellt, wenn es um die Auffindbarkeit bei Google
geht? Das Gesamtergebnis ist leicht zu sehen. Ihre
Seite steht in den Suchergebnissen weiter vorne
oder weiter hinten als der Wettbewerber. Zum Überholen
können Sie aber nur ansetzen, wenn Sie den Vergleich
auf allen beeinflussbaren Teilgebieten kennen. Ist
Ihr Text zu lang? Zu wenige Abbildungen? Zu schlechte
Ladezeit? Sogar Textqualität wird "gemessen". Man
vergleicht also mit Seiten, die es ganz nach vorne
schaffen anhand eines ganzen Katalogs von Kriterien.
Diese Analyse wäre typisch für ein Benchmarking.
In diesem Falle gibt es z. B. ein
kostenloses
Benchmarking-Tool
(Seodiver von Abakus), mit dem das leicht durchzuführen
ist.
Beim Ausprobieren werden Ihnen zwei wichtige Punkte auffallen:
Benchmarking braucht nicht zwangsläufig einen objektiven
Maßstab. Den kennt man einfach nicht immer. Und
man stößt auf Faktoren, die unterschiedlich schwer
oder sogar überhaupt nicht zu beeinflussen sind. Sonst stünde diese Seite beim
Stichwort "Benchmarking" auf Platz 1:
Benchmarking-Diagramm
Natürlich kann Benchmarking sehr komplex und
aufwändig sein. Praktische Strategie wird es meist
erst, wenn wir die gewonnenen Erkenntnisse stark
verdichten. Hier zum Beispiel ein Benchmark-Diagramm,
welches bei jedem betrachteten Wettbewerbsfaktor
nur drei Werte zeigt: Den besten, den schlechtesten
und den eigenen.
Benchmark-Diagramme kann man z. B. mit meineZIELE
erstellen. Im Screenshot sehen Sie drei farbige
Linien, gebildet aus den Bewertungen für die verschiedenen
Wettbewerbsfaktoren. Die grüne Linie besteht aus
den besten Werten aller Wettbewerber, manchmal auch
Primus-Linie genannt. Die rote Linie verbindet die
schlechtesten Werte und die gelbe Linie zeigt die
Werte des eigenen Unternehmens.
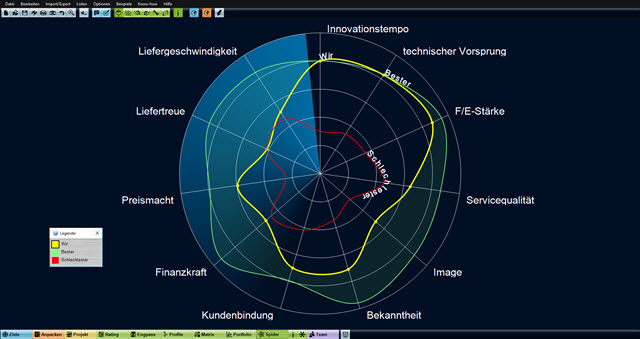
Man erkennt: Beim Innovationstempo und beim technischen
Vorsprung liegt das eigene Unternehmen an der Spitze,
bei der Liefertreue dagegen auf der roten Linie.
Dieses Diagramm hilft also zunächst, sich in die
Bandbreite des Wettbewerbs einzuordnen und man sieht,
wo große oder kleine Potentiale und Rückstände sind.
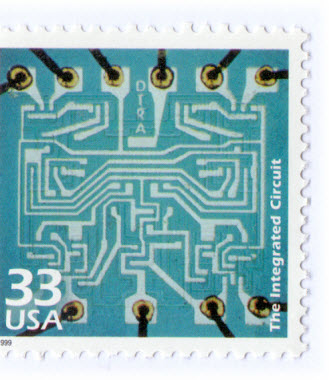 Was
können wir besser?
Was
können wir besser?
Ein Begriff wie
Kernkompetenzen
gibt es nur im Vergleich mit Anderen. Nur etwas,
was man besser kann als Andere, kann überhaupt Kernkompetenz
sein. Benchmarking ist gleich der nächste Schritt,
sobald man zusammengestellt hat, was man überhaupt
kann.
Wie findet man Wasserköpfe?
Warum braucht das eine Unternehmen 10 Personen
in der Buchhaltung und das andere nur 5 ? Mit solchen
Fragen versuchen wir, überbesetzte Abteilungen zu
identifizieren und Personal einzusparen.
Häufig geht das allerdings schief. Die 10 Personen
haben andere Voraussetzungen, andere Bildungsstände,
andere Arbeitsvolumina, andere Mittel und vieles
andere mehr, was den Vergleich erschwert. Die Lösung
des Problems: Genauer nachfragen und nicht nur zwei,
sondern viele Unternehmen zum Vergleich heranziehen.
Das ist Benchmarking.
Vergleichen Sie immer nur funktionierende Strukturen.
Wenn ein anderes Unternehmen an einer Stelle mit
weniger Personal auskommt, die gewünschte Leistung
aber nicht bringt, nützt der Vergleich nichts. Die
Wasserköpfe findet man nicht nur da, wo viel Personal
gebraucht wird, sondern wo auch gleichzeitig die
Leistung nicht stimmt, Innovationswiderstände hoch
und Reaktionsgeschwindigkeiten niedrig sind. Das
sind Zeichen, dass Personal Zeit und Muße findet,
sich mit sich selbst zu beschäftigen.
Wie funktioniert Benchmarking?
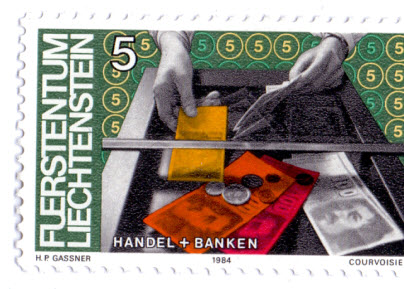
Vergleiche zielen nicht nur auf Mitarbeiterzahlen
ab, sondern auch auf Kosten und Erträge. Beim Benchmarking
setzt man daher auf mehrere Datenkomplexe. Analysiert
man ein Unternehmen oder, was sinnvoller ist, Unternehmensbereiche,
dann teilt man zunächst den Bereich in seine Geschäftsprozesse
auf. (Beispiel: Bereich Finanzen enthält z. B. Geschäftsprozess
Zahlungsverkehr mit Lieferanten)
Für jeden Geschäftsprozess ermittelt man die
verfügbaren Mittel (z. B. Umfang, Art, Alter der
benutzten EDV-Systeme). Zweitens wird funktionell
abgegrenzt, welche Funktionen im speziellen Fall
dieses Unternehmens besonders ausgeprägt sind oder
welche vielleicht ganz wegfallen. Man ermittelt
Besonderheiten und die Leistungstiefe. Drittens
schließlich werden natürlich die Volumen-Angaben
benötigt (z. B. wie viele Zahlungen im Jahr, wie
viele Kunden, Lieferanten ...)
Mittels einer Kosten- oder Personenmatrix wird
nun aufgeschlüsselt, welche Personen einzelne Prozesse
bearbeiten oder welche Kosten (z. B. durch Externe)
dafür anfallen.
Neben diesen Geschäftsprozess-orientierten Daten
werden natürlich auch Umsatz- bzw. Personal-bezogene
Daten verglichen (z. B. Ausbildungsstand, Berufserfahrung,
verbrachte Zeit in dieser Position, etc.). Mit der
Gesamtmenge dieser Daten lässt sich nun relativ
genau bestimmen, wie es um die Leistungsfähigkeit
eines Unternehmensbereiches steht, verglichen mit
anderen Unternehmen vielleicht des gleichen Konzerns,
der gleichen Branche etc.
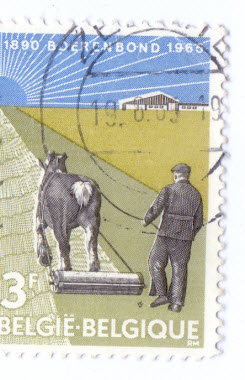 Offenkundige
Unterschiede
Offenkundige
Unterschiede
Benchmarking braucht nicht immer komplexe Zahlenmodelle.
Manchmal sind die Unterschiede so offenkundig wie
bei den abgebildeten Landwirtschaften mit und ohne
Maschineneinsatz. Bei der Bewertung von Kompetenzen
beispielsweise greift man auf ganz simple 5 Punkte
Skalen zurück: Gar nicht vorhanden, schlecht, mittel,
gut und Weltklasse. Alles Andere ist bei den "weichen
Faktoren" doch nur Kaffeesatzleserei.
Wo liegen Probleme?
In der Praxis erweist sich Benchmarking als durchaus
problematisch. Hier einige Gründe:
- Diese Datensammlung ist sehr umfangreich.
Sie wird zwangsläufig von Menschen erstellt
mit fundierten Detailkenntnissen, von Menschen
also, die Beteiligte und damit Befangene sind.
- Benchmarking kann nicht alle Fragen stellen.
Manchmal fehlt die Entscheidende! Treffen Sie
niemals folgenreiche Entscheidungen alleine
aufgrund dieses Zahlenmaterials.
- Im Bereich kleiner Zahlen, (z. B. Abteilungen
mit nur 5 Personen) werden Sicherheits-Overheads
benötigt, was Vergleiche verzerrt.
- Benchmarks betrachten häufig nur ein momentanes
Bild und berücksichtigen Entwicklungen, starkes
Wachstum oder Rückgänge unzureichend.
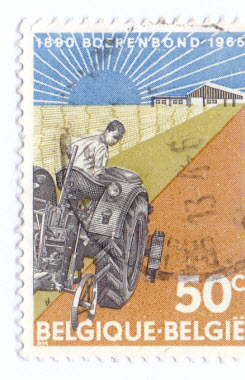
- Internationale Benchmarks wurden z. B. für
die USA entwickelt und berücksichtigen zu wenig
kulturelle, gesetzliche etc. Unterschiede.
- Es entsteht Rechtfertigungsdruck, der die
Suche nach Engpässe in falsche Richtungen lenken
kann
- Benchmarking ist Steckenpferd vieler Unternehmensberater.
Deshalb ist manchmal die Generierung neuer Probleme
wichtiger als einfache Erkenntnisse und deren
Umsetzung ...
Typische Negativ-Beispiele:
Ein Benchmark für die Durchlaufgeschwindigkeit
ergibt: Zwei kleine Konzern-Tochtergesellschaften
in Spanien und Norwegen sind weitestgehend vergleichbar.
Beide produzieren nicht, sondern liefern nach einer
kleinen Endmontage Waren aus einem Auslieferungslager
an die Kunden. Beide Unternehmen erzielen die gleiche
Liefergeschwindigkeit mit unterschiedlichen Personenzahlen
in der Versandabwicklung.
Kein Manager kannte im Detail beide Unternehmen.
Am grünen Tisch wurde entschieden, die Norweger
zu Personalabbau aufzufordern. Nach ärgerlichen
und emotional geprägten Diskussionen fand man Wochen
später eine Erkenntnis, die beim Benchmarking durch
die externe Beratung gar nicht erfragt wurde: Das
spanische Unternehmen erzielt seine Leistung nur
11 Monate im Jahr und hat im August geschlossen
... Außerdem hatten die Spanier ihre Reklamationszahlen
so stark manipuliert, dass am Ende doch das norwegische
Unternehmen mit der besseren Leistungsbilanz dastand.
Von den Besten lernen - und von der Konkurrenz
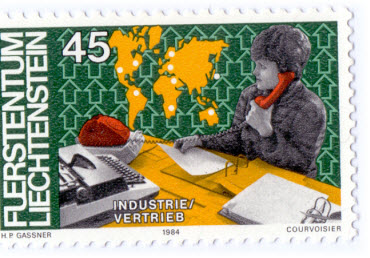 Benchmarking
wurde nicht nur zu Vergleichszwecken erdacht. Die
wichtigsten Erkenntnisse gewinnt man nicht durch
nebensächliche Zahlenkrämerei. Es ist vielmehr der
direkte Vergleich mit dem Besten der Branche oder
mit den unmittelbaren Wettbewerbern, die entscheidende
Impulse liefern. Was genau macht der Branchenführer
besser? Und genau davon müssen wir lernen, um es
eines Tages übertreffen zu können.
Benchmarking
wurde nicht nur zu Vergleichszwecken erdacht. Die
wichtigsten Erkenntnisse gewinnt man nicht durch
nebensächliche Zahlenkrämerei. Es ist vielmehr der
direkte Vergleich mit dem Besten der Branche oder
mit den unmittelbaren Wettbewerbern, die entscheidende
Impulse liefern. Was genau macht der Branchenführer
besser? Und genau davon müssen wir lernen, um es
eines Tages übertreffen zu können.
Besser als der Beste
Wenn man zwei Angebote vergleicht, die für ein
Bau-Gewerk eingereicht wurden, dann erstellt man
oft auch noch das "Optimal-Angebot", das
aus der Summe der jeweils günstigsten Angebote aller
Positionen besteht. Und oft genug wird dann auch
versucht, den günstigsten Anbieter auf dieses fiktive
Ideal-Angebot zu drücken.
Entsprechend gibt es auch für Wettbewerber einen
"Optimal-Wettbewerber".
Das ist ein fiktives Unternehmen, das auf allen
Gebieten, von den Finanzen über Liefertreue bis
zum Innovationstempo, den jeweils besten Wert der
Branche erreicht. Dieses Ideal-Unternehmen kommt
in der Realität noch seltener vor, als auf dem Bau
ein Ideal-Angebot abgegeben wird. (Denn jeder Wettbewerber
braucht langfristig eine Nische, in der er besser
ist als jeder Andere)
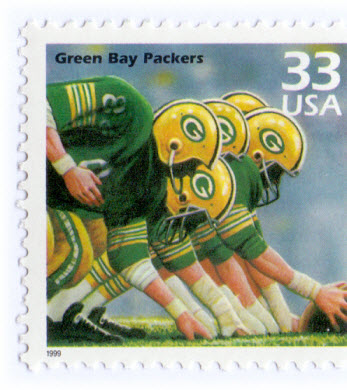 Erfolgsfaktoren
haben viele Gesichter: Ein "gesundes Feindbild", so hat man herausgefunden,
zählt zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren eines Unternehmens.
Mannschafts-Sportarten kommen zur Motivation kaum
ohne sorgfältig gepflegte Feindbilder aus.
Erfolgsfaktoren
haben viele Gesichter: Ein "gesundes Feindbild", so hat man herausgefunden,
zählt zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren eines Unternehmens.
Mannschafts-Sportarten kommen zur Motivation kaum
ohne sorgfältig gepflegte Feindbilder aus.
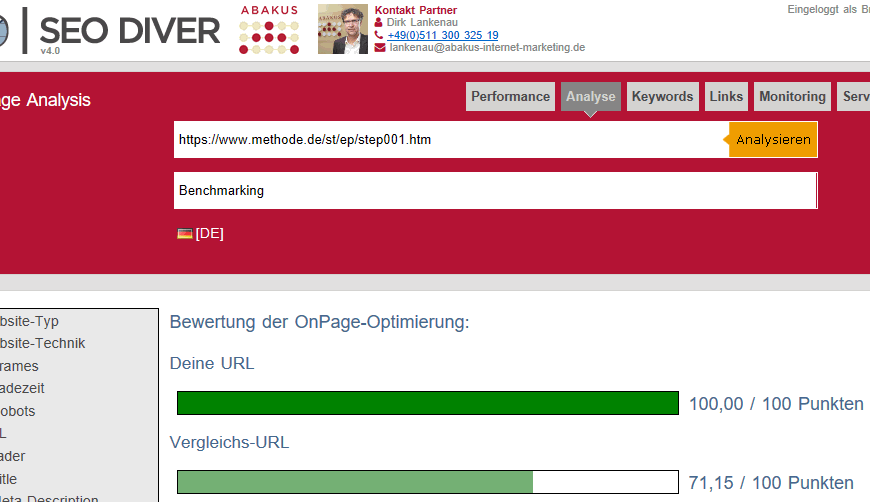
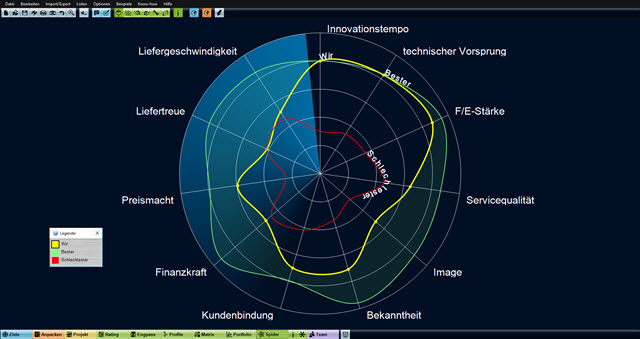
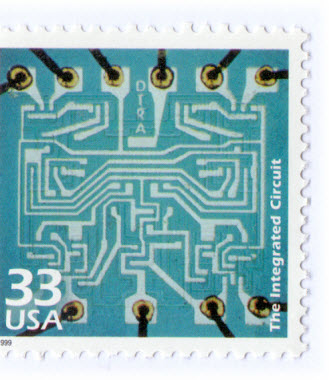 Was
können wir besser?
Was
können wir besser?
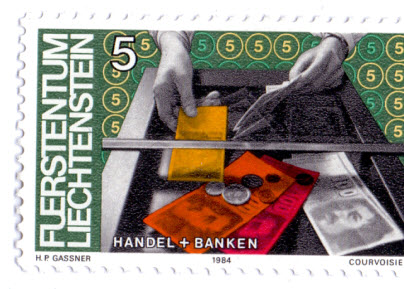
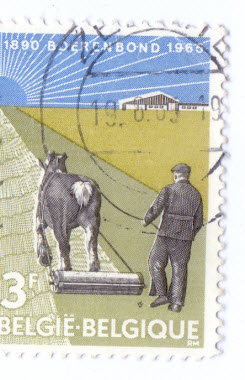 Offenkundige
Unterschiede
Offenkundige
Unterschiede
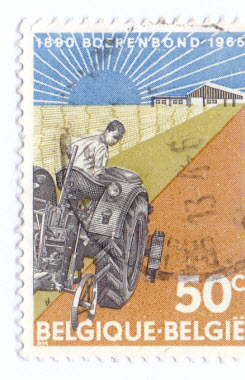
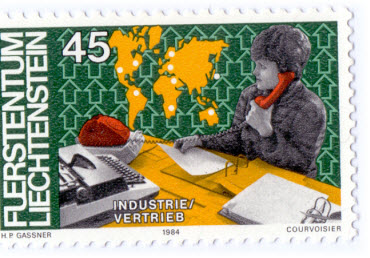 Benchmarking
wurde nicht nur zu Vergleichszwecken erdacht. Die
wichtigsten Erkenntnisse gewinnt man nicht durch
nebensächliche Zahlenkrämerei. Es ist vielmehr der
direkte Vergleich mit dem Besten der Branche oder
mit den unmittelbaren Wettbewerbern, die entscheidende
Impulse liefern. Was genau macht der Branchenführer
besser? Und genau davon müssen wir lernen, um es
eines Tages übertreffen zu können.
Benchmarking
wurde nicht nur zu Vergleichszwecken erdacht. Die
wichtigsten Erkenntnisse gewinnt man nicht durch
nebensächliche Zahlenkrämerei. Es ist vielmehr der
direkte Vergleich mit dem Besten der Branche oder
mit den unmittelbaren Wettbewerbern, die entscheidende
Impulse liefern. Was genau macht der Branchenführer
besser? Und genau davon müssen wir lernen, um es
eines Tages übertreffen zu können.